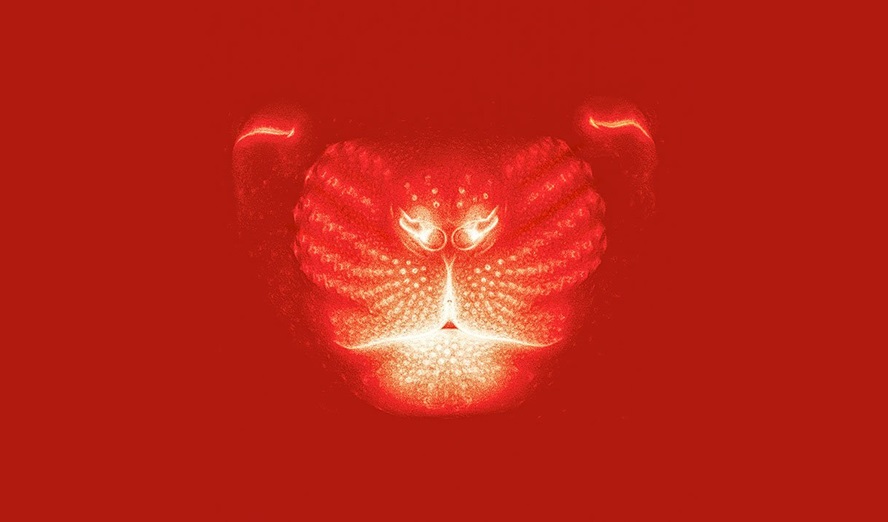»Retropie«: Mit diesem schönen Wort bezeichnete der Wiener Filmkritiker Michael Omasta unlängst im »Falter« Quentin Tarantinos neu(nt)en Film »Once Upon a Time in Hollywood«. Das Wort mag unvertraut klingen, zumal es eine Verdichtung des – auch nicht viel gängigeren – Wortes »Retrotopie« ist. Aber das, was es bezeichnet, ist Leuten, die gerne Mainstreamfilme sehen, durchaus geläufig, nämlich aus früheren Tarantino-Filmen wie »Inglourious Basterds« und »Django Unchained«, dort in Form von Rache, Klamauk, Geschichtskontrafaktik – und der Idee, dass jene, die sonst (im Film) als passive Opfer erscheinen, dieses eine Mal zu(rück)schlagen. Statt der Utopie, der Hoffnung auf Anderes in der Zukunft, gilt der Wunsch der Retropie einem anderen Verlauf der Vergangenheit.
Es war einmal in Hollywood, 1969. Da geht nun der Wunsch dahin, dass für drei Blonde ihre Zeit noch nicht vorbei sein möge. Nicht für zwei alternde Männer, die schon lange als Fernsehhelden jobben, nicht für eine junge Frau, die im Kino kurz hip war. Letztere ist Sharon Tate, die Ehefrau von Roman Polanski, die in den späten 1960ern ihre ersten Hollywood-Hauptrollen spielte, hier dargestellt von Margot Robbie. Sie soll uns in »Once Upon a Time in Hollywood« ans Herz wachsen, indem sie – etwa als Besucherin der Kinovorführung eines ihrer Filme – dauergrinst, dankbar für ein bisschen Stardust. Viel Zeit, um uns sympathisch zu werden, hat sie nicht; Coolness-Etüden sind den Männern vorbehalten und in diesem Film, der sich, wie üblich bei Tarantino, mit allem ostentativ viel Zeit nimmt, tickt ihre Uhr schnell: Ihre Szenen sind kurz, und das Umherschleichen der sektenkommunardischen Manson-Family am Rand der drei Parallelplots betrifft die Tate-Figur als das Menetekel jenes Massakers, das im echten August 1969 erfolgte. Ganz nach Art der barocken Ressentiment-Dramaturgien jener Katastrophenfilme, die im echten Hollywood ab 1969 zum zeitweiligen Haupterfolgsprodukt avancierten: Genießt nur die Sonne, euren Reichtum, eure Schönheit und grinst nur blöd, bald wird’s rund um euch rumpeln.

Ältere Herren finden Erfüllung
Eindeutiger geht in dem Film der Wunsch der beiden Männer, es möge doch bitte noch viel kommen, in Erfüllung: Das Märchen aus der spätfordistisch krisengebeutelten Traumfabrik (das Blockbusterkonzept produzierte noch zu viele Flops, am Publikum vorbeivermarktet, und wurde erst 1975 mit Spielbergs »Jaws« Industrie-übergreifend tragfähig) schenkt den Altherren Screen Time. Die Blondzeit ist nicht ganz um. Der ramponierte TV-Cowboy-Held (Leonardo DiCaprio) läuft bei einem seiner zahllosen Drehs als Serienschurken-Gaststar noch einmal zur Hochform auf, angespornt durch sein Selbstmitleid und eine altkluge Kinderdarstellerin. Sein Stunt-Double-Buddy versagt sich derweil den Blowjob, den eines der Manson-Mädchen (Margaret Qualley), unerschrocken auch sie, ihm im Auto offeriert. Nein danke, lieber nicht. Lieber prügelt er bei seiner kunstvoll zerdehnten Stippvisite auf der Filmkulissenranch, auf der die Family haust, das einzig greifbare männliche Sektenmitglied zu Brei. Nach der Zurückhaltung im Suspense – und der Begegnung mit einem bettlägerigen Greis (Bruce Dern), barock auch dies – kommt das regelrecht einer Ejakulation gleich.
Das ist so vordergründig gesagt, wie der Film es handhabt, einerseits als Nachhall zu der homomorphen Intimbeziehung zwischen Altstar und Altdouble (»I’m carrying his load«), andererseits als Vorwegnahme einer finalen Retropie-Erfüllung, die so wenig gespoilert sein darf, wie dass der echte Hitler gar nicht in Paris in einem Kino starb. Am Ende also weniger eine Rettungsfantasie (obwohl, das auch, sogar ein bissl rührend) als vielmehr eine flammenwerfer- und kampfhundgetriebene Rehabilitierung des alten Regimes der brutalen weißen Blondschöpfe, die groß auftrumpfen, gegen Fan-psychotische Mörder, die sie immer nur »Hippies« nennen. Wie in der echten Fabrik der rechten Träume: eine Welt ohne Hippies; der Einschnitt von Masseninsubordination, den die Trivialchiffre »1968« bezeichnet, durch die Beschwörung von »1969« gelöscht; Abtreibung demnächst wieder illegalisiert; alte wohlhabende weiße Zwangshetero-Männer demnächst wieder in jene Würden eingesetzt, die ihnen die Neuen Sozialen Bewegungen jahrzehntelang vorenthalten haben. In diese Richtung denkend, betitelte Omasta seine Retropie-Rezension von »Once Upon a Time in Hollywood« mit »Make Hollywood Great Again«.
Zweimal als Farce (das ist die Tragödie)
Der Wunsch nach etwas Anderem in der Vergangenheit, er führt hier in ein Immergleiches: in die – nach einer Unterbrechung – fortgesetzte Weiterherrschaft dessen, was ohnehin vorherrschend war. Mag sein, dass das, ein wenig geschichtsmystisch angespielt, schon in verschiedenen Facetten des Jahres 1969 angelegt ist: der Beginn der Liquidierung des anormalen Empowerment von 1968 (eine lange Liquidierung, wie sie heute die FPÖ gequält und die Kurz-ÖVP gegelt betreibt); all die Sündenfälle der Jugend- und Subkultur und der libertären »Rock Formation« (Larry Grossberg), von Altamont bis Bombast-Genudel-Sound; ein klassisches Live-Album von Johnny Cash aus jenem Jahr, auf dem – was wohl nicht oft auf Live-Alben vorkommt – das albumtitelgebende Lied zweimal hintereineinander drauf ist. Es handelt von endloser Einsperrung in Monotonie und heißt »San Quentin«.
Kontinuität als Wiederholung: Eine Art humoristisches Bewusstsein davon verrät »Once Upon a Time in Hollywood« durch seine Fokussierung auf ein »odd couple«, bei dem die Doublette von Darsteller und Stunt-Double mit zwei gleichkalibrigen und einander nicht unähnlich sehenden Stars besetzt ist: Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Sowas schneidet ins Fleisch jener durchkapitalisierten Wahrnehmung, auf die Hollywood-Konzeptkino abzielt, weil es in einem Mangel an Variation und »Auswahl« fürs Auge resultiert, hochredundant insbesondere im Verhältnis zum Aufwand für Gagen und Drehzeitpläne. (Sowas ist super und sollte eigentlich öfter gemacht werden: Wo sind sie, die großen Filme mit Ryan Gosling und Ryan Reynolds oder mit Julia Roberts und Jessica Chastain in den Hauptrollen?)

Einführung ins stilechte Farbfernsehen ohne Geschichtsreibung
Den Blonden bleibt noch Zeit. Waschbrett Pitt zeigt seinen Bauch; er ist noch flach und jung. Er tut dies just beim Justieren einer Fernsehantenne (fragen Sie Ihre Großeltern, was das war und warum mensch das tat). Auch Fernsehen ist hier noch flach (bis auf die Bildschirme) und fast noch jung. Wir empfangen ein Signal aus der Vergangenheit, und das Signal meint uns, zeigt uns unsere heutigen Vorlieben und dass sie immer schon die Welt regiert haben. Mag sein, dass dieser Film ein Hollywood-Abgesang ist; vor allem aber ist er ein Wiegenlied für die Frühblütezeit von Serienfernsehen: Alles wie heute – die Leute im Film bingen mit »Bonanza«, schauen manisch »Mannix«, trinken drei zu »FBI«. Und alles wie immer: Die Tonspur ist Dauerwerbesendung (zumal aus dem Autoradio bei einer der vielen Ausfahrten durchs auf alt ausgestattete Los Angeles), jeder Kader voller Logos und Zitate. Wie stets chez Quentin: Namedropping, Bildbeschriftung, Obergscheitheiten in Sachen Konsumkulturdetailhistorie, die mittlerweile so routinemäßig zum Mitgscheiteln auffordern, dass du lieber ahnungslos sein möchtest (sei es aus Renitenz, sei es, weil warum nicht?). Je flotter die Sixties-Pop-Montagen dir das Styling einer Zeit, von der es heißt, sie sei sehr bunt und so, mit dem Arsch ins Gesicht drücken, desto öder. Schöne Phrasierungen gelingen hier durchaus auch, etwa in einigen disruptiven Schnitten von Dialogszenen (hat schon mal jemand darauf hingewiesen, dass die bei Tarantino meistens lang und gar nicht immer lustig sind? Beides muss irgendwie Absicht sein.) oder in einem Showdown, der abläuft zum Gegenrhythmus von »You Keep Me Hanging On« in der Zehn-Minuten-Zerdehn-Version von Vanilla Fudge.
Aber eh: Das Blond blendet noch, der Bauch steht noch, die Marke trägt noch. Träge, aber es reicht für eine seichte Synthese aus Tarantinos Eigeneinmachklassik. Ein Quantum Quentin in mildem Klima, ohne viel Geschichtsreibung (und Geschichtsschreibung) diesmal, also im Unterschied zu Tarantinos anderen Feuertod-Finale-Filmen. Sprich: Da war mal was mit diesem DJ NGO und seinen Blackness-Kultivierungen (im Märchen-Hollywood rund um Brad und Leo haben African Americans hingegen offenbar Hausverbot) und bei diesem Film mit dem Schreibfehlertitel damals mit diesen Nazis wusste man, dass die irgendwie mit diesem Hitler zu tun hatten oder mit diesen Juden, irgendsowas war da – im Gegensatz also zu unseren als gegeben voraussetzbaren Geschichtsaffinitäten in Sachen Slavery History und Spätphase nationalsozialistischer Herrschaft verbinden wir (die wir immer auch wir sind) mit 1969 vielleicht gar nicht sooo wahnsinnig viel. (Abgesehen von: Letzte ÖVP-Alleinregierung vor der nächsten… »Kino, Kult & Kanzler Klaus«, das Wickie, Slime & Paiper« derer, die heute in ihren späten Sechzigern sind.) Jedenfalls weder genug, dass die Fallhöhe des retropischen Wunsches sehr groß gerät, noch genug, dass es gerechtfertigt wäre, zu behaupten, wie es der kleinbürgerliche Diskurs tut, dieser Film versprühe Nostalgie nach dem Hollywood von 1969. Vielleicht gilt hier (auch in tune mit den retrokulturellen Großzyklen, wie sie in der Provinz, von Wien bis Wieselburg, durchaus verbindlich sind) die Primärnostalgie ja doch eher den 1990ern, der Spätpostmoderne und diesen Gaudiwurzenfilmen, wo die Leute mit zum V gespreizten Fingern vor den Augen Twist getanzt haben. Es ist eine Sehnsucht nach Tarantino, die hier bespielt wird. (Übrigens durchaus erfolgreich: Bei manchen langen Filmen denkst du mit Wehmut an deren Anfang zurück, und das nicht nur, weil du damals noch jünger warst.) Ein Märchen erfüllt uns den Wunsch nach mehr vom Selben: Er soll noch einmal kommen, der liebgewonnene Partygast beim Sockenfest, der immer so schnell so viel über Filme redet, die keine*r kennt, aber alle kennen wollen müssen, und er soll doch welche von seinen alten Witzen als Präsent mitbringen und wieder was von seinem hausgemachten retro pie.
Drehli Robnik ist Theoretiker in Sachen Film und Politik, Nebenerwerbsessayist, Gelegenheitskritiker, musikbasierter Teilzeit-Edutainer. »Lebt« in Wien-Erdberg. (Mit-)Herausgeber von Siegfried Mattls Filmschriften, Bänden zu Siegfried Kracauer und »Put the X in Politix. Machtkritik und Allianzdenken mit den X-Men-Filmen« (Berlin 2019). Monografien: »Geschichtsästhetik & Affektpolitik« (zu Anti-Nazi-Widerstand im Kino/TV, 2009), »Film ohne Grund« (zu Jacques Rancières Film/Politik-Theorie, 2010), »Kontrollhorrorkino: Gegenwartsfilme zum prekären Regieren« (2015).
Link: https://www.onceuponatimemag.com/