Wo liegt Tago Mago? Bei Ibiza, sagen Tourist*innen, und im Besitz eines Hamburger Immobilienunternehmers. Auf dem Plattenteller, sagen die anderen. Spannend, dass sowohl die Insel als auch das gleichnamige Album von Can etwas mit Deutschland zu tun haben. Eingekauft hat sich die Kölner Band immerhin nicht, ihr »Tago Mago« ist eine Insel vollkommen eigensinniger Kompositionen, minimalistisch-rhythmusgetrieben, sphärisch-abgründig oder voll kreischender Performance-Kunst. Das hatte man 1971 noch nicht gehört, auch nicht im Nachfeld von »Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band«, »Trout Mask Replica« und Frank Zappa. Und seien wir ehrlich: Noch einmal haben weder Can noch irgendwer anderer etwas ähnlich Sonderbares fabriziert.
»Tago Mago« bildet den Fixstern dessen, was international als Krautrock bezeichnet wurde und heute in der Tag-Cloud jeder dritten Post-Punk-Band steht. Meist verweist man damit auf deutsche Musik rund um 1970, wobei die Ausläufer und Verzweigungen zahlreich sind und teils bis heute bestehen. Während David Bowie 1997 auf der Couch von Thomas Gottschalk noch ungläubig zur Kenntnis nehmen musste, dass nur eine Person im »Wetten Dass..?«-Publikum die legendäre deutsche Krautrock-Band Neu! kannte, sieht es mittlerweile besser aus. Spätestens Christoph Dallachs 2021 erschienene Oral History »Future Sounds. Wie ein paar Krautrocker die Popwelt revolutionierten« stieß auch gediegene deutsche Bildungsbürger*innen auf das vergessene Kulturerbe. Dabei war der kleinste gemeinsame Nenner aller Krautrock-Kombos eigentlich die Abkehr von allem deutschen Erbe – oder wie Chronist Wolfgang Seidel mit seinem 2016 erschienenen Krautrock-Buch stellvertretend für seine Musiker*innengeneration titelte: »Wir müssen hier raus!«.
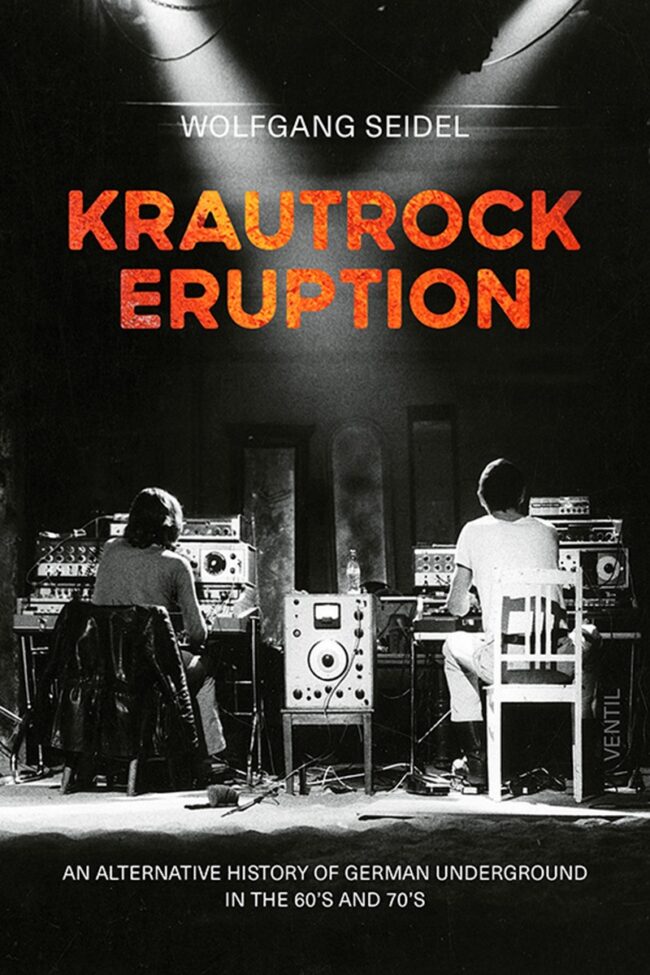
Krautrock lebt und eruptiert
Wolfgang Seidels nun im Englischen unter dem Titel »Krautrock Eruption« veröffentlichte und von skug-Autor Holger Adam um eine Diskografie erweiterte Geschichtsstunde markiert die fortlaufende Auseinandersetzung mit dem Phänomen. Seidel interessiert sich dabei überraschenderweise nicht nur für die Musik, sondern auch für Infrastruktur, Wohnen und Politik und was das alles für den Krautrock bedeutete. Noch konkreter geht Musiker und Schriftsteller Hendrik Otremba (Messer) mit seinem Essayband »Can« vor. Im akademischen oder raunenden Duktus streift Otremba durch Nachkriegsruinen, vorbei an den »Alien Singers« der Band und versucht, dem letzten lebenden Mitglied, Irmin Schmidt, Sinnsprüche zum Gesamtkunstwerk Can zu entlocken. Michael Fuchs-Gamböck und Michael Joseph schaffen hingegen etwas grundlegend Neues: die weltweit erste Monografie zu »Popul Vuh«, dem Projekt des Münchener Klangkünstlers Florian Fricke. Ihr ebenfalls eher essayistisches Buch widmet sich verschiedenen Stationen auf dem Weg Popol Vuhs und blickt auf Weggefährten wie Regisseur Werner Herzog. Auch die sonst oft belächelte Esoterik Frickes erhält Wertschätzung. Alle drei Veröffentlichungen beweisen: Krautrock is alive oder eruptiert weiter, um mit Wolfgang Seidel zu sprechen.
Apropos Wolfgang Seidel: Der ist vor allem als Mitbegründer der Politrocker Ton Steine Scherben bekannt und damit nicht gerade die erste Person, die einem angesichts des sphärisch-esoterischen oder mechanisch-kalten Krautrock in den Sinn kommt. Als »fly on the wall« (Klappentext) ist der umtriebige Berliner aber genau deshalb besonders geeignet: ein cooler Typ, der alles beobachtet hat und trotzdem auf kritischer, klassenkämpferischer Distanz bleibt. Lobgesänge zum Krautrock gibt es schließlich genug, ob sie nun von Musikern wie David Bowie, Public-Image-Ltd-Frontmann John Lydon (der selbst einmal bei Can spielen wollte) oder Autoren wie Hendrik Otremba kommen, der in seinem neuen Essayband von Can nur wie von einem »Mythos« schreiben kann und gegenüber der Musik an einer Stelle haucht: »Da fehlen mir die Worte: Soup [Track vom Can-Album »Ege Bamyasi«], spätestens ab Minute 1:25! Man wird verstehen…« Und Michael Joseph, einer der Autoren der neuen Popol-Vuh-Monografie? Der sucht in der Musik Florian Frickes nach nichts Geringerem als dem »Spirit of Peace«. Am Ende beider Bücher steht selbstverfasste Lyrik, die Can bzw. dem 2001 verstorbenen Fricke huldigt: »Die Musik wird nie verklingen / Sie ist das, was uns erhellt« (Henrik Otremba). Rolf-Ulrich Kaiser, verschollener Plattenproduzent und Kraut-Esoteriker, hätte die beiden seinerzeit direkt für die Plattentexte seines Labels Kosmische Kuriere akquiriert.
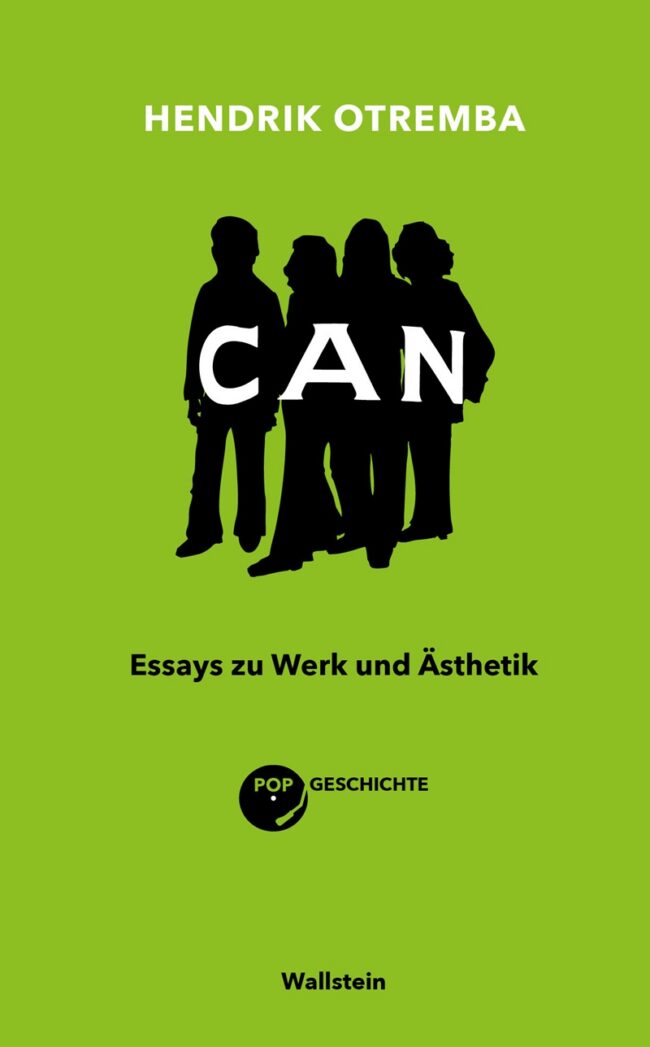
Can: Ruinen und Grooves
Wolfgang Seidel lässt die Räucherstäbchen in »Krautrock Eruption« von Beginn an beiseite und schaut auf die alternative Infrastruktur der frühen 1970er. Zu dieser Zeit erlebten die selbstverwalteten Jugendkulturzentren einen kleinen Boom. Sie waren nicht nur Vorläufer der Besetzerszene der 1980er, sondern auch Brutstätte für die Musik, die später als Krautrock bekannt wurde. Das Nachkriegsdeutschland, so das populäre Bild, an dem sich Seidel und auch Hendrik Otremba orientieren, ist eine Ruinenlandschaft, aus der neues Gras wächst oder die Raum für neue Musikarchitekturen lässt. Dass die nicht unbedingt mit den staatlichen Bauämtern abgestimmt waren, dürfte nicht verwundern. Die langhaarigen Rocker oder Antirocker spielten eine Musik, die dem Konflikt zwischen Altnazis und Jungen einen lärmenden Soundtrack gab. Der Sommer der Liebe war definitiv vorbei. Das Düsseldorfer Duo Neu! schichtete im vielsagenden Track »Negativland« Gitarrenlärm auf stoische Beats, die Berliner Kluster (später Cluster) setzten auf unheimliche »Klopfzeichen« und Can ließen auf ihrem Album »Tago Mago« eine atombombenartige Explosion hören. Nicht zu Unrecht schreibt Seidel von einem »sense of gloom« im Krautrock.
Danach immerhin setzt der ewige Can-Groove wieder ein. Schon die Avantgarden um 1900 oder später der Post-Punk, der dem Krautrock viel verdankt, lebten im Miteinander von Zerstörung und Neugestaltung. Für Irmin Schmidt, Keyboarder und letztes noch lebendes Mitglied von Can, entsteht die neue Musik aus der Collage. Im lesenswerten Interview, das Henrik Otrembas sonst verkopftem Essay vorangestellt ist, erzählt Schmidt vom Prozess der Montage. Zusammen mit Bassist Holger Czukay setzte er unterschiedliche Passagen gemeinsam improvisierter Musik am Schneidetisch neu zusammen, wobei der Groove des Schlagzeugers Jaki Liebezeit niemals geopfert werden durfte. Zusammengehalten wurde die Collage etwa durch den Sänger Damo Suzuki, der auch Elemente japanischer Musik oder der Pekingoper in den Rocksound von Can brachte. Ansonsten gaben Karlheinz Stockhausen, John Cage und der Free Jazz wichtige Impulse. Wichtig ist auch Otrembas Hinweis auf die Cut-up-Methode, die in der Montage Cans ihre musikalische Entsprechung fand. »When you cut into the present, the future leaks out«, schreibt Cut-up-Experte William S. Burroughs. Der Krautrock strahlte aus der ruinösen Nachkriegsgegenwart in die Zukunft: »Future Days«, wie Cans zärtlichstes Album schon im Titel verkündet.
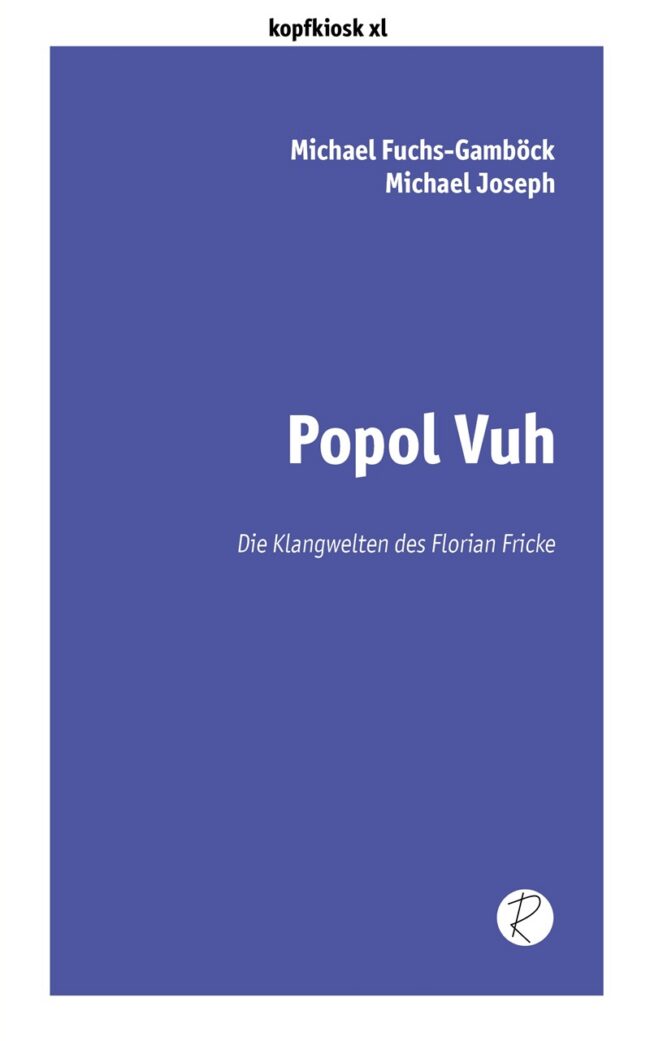
Popul Vuh: Evolutionäre Affenstunden
Zukunftsträchtig waren Popul Vuh in jedem Fall. Mit seinem Musikprojekt brachte der Münchner Florian Fricke klassische, kirchliche oder anderweitig religiöse Musiktraditionen und moderne Klangtechnik zusammen. Auf dem schrillen Debüt der Band »Affenstunde« von 1970 spielte Fricke einen der ersten Moog-Synthesizer Deutschlands. Damals ein sehr teures und immens schweres (über 100 Kilogramm!) Klangsystem, das ohne Beratung durch einen Elektriker (in diesem Fall Kamera- und Soundmann Frank Fiedler) nicht zu bedienen war. Auf diesem Gerät schuf Fricke Klänge, die unheimlich und unberechenbar sind. »Affenstunde« – damit wollte er den evolutionären Moment der Menschwerdung beschreiben. Musikalisch evolutionär war das in jedem Fall. Auch Stars wie John Lennon und Bob Dylan zeigten sich begeistert. Wirklich groß wurden Popol Vuh aber erst auf ihrem zweiten Album »In den Gärten Pharaos« (1971), speziell dem monumentalen Orgel-Drone »Vuh«: 20 Minuten wuchtige Klangschichten und scheppernde Percussion. Selten in der Musikgeschichte wurde religiös-esoterische Musik so physisch, fast schon gewalttätig rübergebracht.
Schon ein Jahr später, und für manche mit Bedauern, war Popol Vuhs magische Moog- und Drone-Zeit vorbei. Fricke: »Der Moog konnte einem schnell aus dem Ruder laufen, das ging wirklich auf die Psyche.« Interessierte wurden fortan an Tangerine Dream weitergeleitet, auf dem legendären Album »Zeit« (1972) hatte Fricke einen Moog-Gastauftritt. Auf dem nächsten und beliebtesten Popol-Vuh-Album »Hosianna Mantra« ist dagegen eine unwahrscheinliche Mischung aus psychedelischer Gitarrenkunst und kirchenmusikalischen Traditionen zu hören. Kooperationen mit der bayerischen Regie-Ikone Werner Herzog und weitere esoterische Klangkreationen folgten (etwa »Sei still, wisse ICH BIN« von 1981), wobei die Besetzung um Fricke wechselte. Die Mission blieb gleich: Musik mit »heilender Kraft« zu schaffen.
All die magischen, spannenden Exkursionen Popul Vuhs beschreiben Michael Fuchs-Gamböck und Michael Joseph plastisch und mit vielen O-Tönen aus der Klangwerkstatt Florian Frickes. Ihr Buch, das für Kenner*innen zwar keine Geheimnisse lüftet, ist ein guter Einstieg für Neugierige. Es ergänzt Wolfgang Seidels handfeste Analyse der soziokulturellen Ursprünge des Krautrock und hebt sich angenehm von den akademischen Exkursen Hendrik Otrembas ab. So gesehen gibt es also genügend Gründe, sich weiter mit dem Krautrock zu beschäftigen. Wer nebenbei dann noch »Tago Mago« hört, hat eigentlich alles verstanden.



















