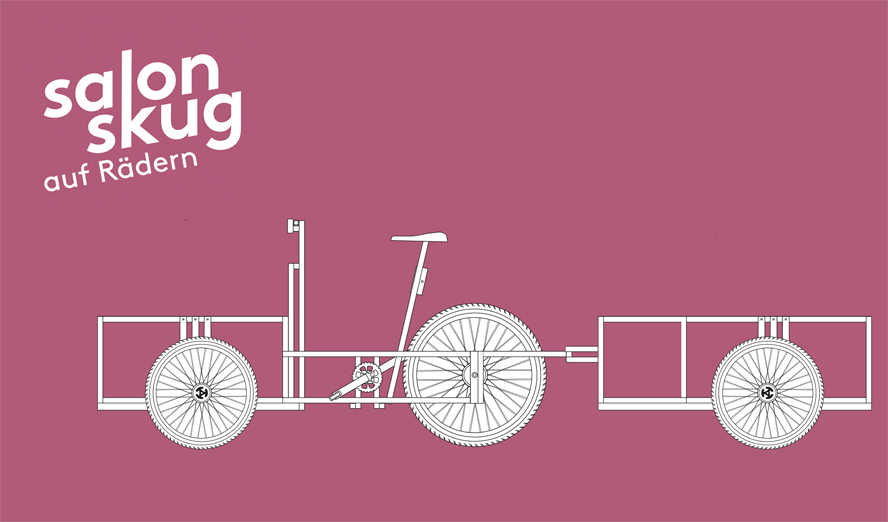»Wie der angefangen hat zu malen, war ich so überrascht. Er hatte die Möbel bemalt und fragte mich, was er mit den restlichen Farben machen sollte. Dann sagte ich, malst halt ein Bild«, erzählt Liliane Roubicek in ihrer schönen, ganz in beige gehaltenen Wohnung in Alterlaa, unter den Öl- und Gouache-Bildern ihres Mannes sitzend. »Er meinte, er brauche eine Beschäftigung für die Pension und ging 1967 in die Künstlerische Volkshochschule zu Professor Matejka-Felden.« Die damals 23-Jährige aus Sandleiten hatte sich ganz alleine entschlossen, einen Ûberlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz und des Todesmarsches nach Buchenwald zu heiraten. Sehr mutig! Lilly fragte nicht einmal ihre Mutter und besprach sich auch nicht mit einer Freundin. »Der war es eben«, lacht sie heute. »Der Fritz hatte eine Gabe, er konnte gut erzählen und er war gebildet, das hat mir imponiert.« An der Ecke des Park Cafe traf sie auf der Station der 43er-Straßenbahn die Mutter ihrer Schulfreundin Jutta Vitek, die beide vor dem Krieg im »ersten Teil« des Sandleitenhofes wohnten. »Die waren in einem Lager gewesen, vermutlich in Ravensbück, sie hatten einen englischen Fallschirmjäger in Sandleiten versteckt.« Nun lebten Anni und Jutta Vitek oben am Wilhelminenberg im Lager für die Rückkehrenden aus den Konzentrationslagern, einem Auffanglager für alle Menschen ohne Unterkunft – wahrscheinlich ein Displaced Persons Lager. Es mangelte an allem, vor allem an Lebensmitteln.
Etwas gut machen
»Jöh, da kommt einer vom Lager, sagte die Mutter und stellte mir den Fritz vor. Das war’s und er hat mich nicht mehr ausgelassen. Kam immer Spazieren nach Sandleiten.« Lilly Roubicek zog 1927 nach Sandleiten, in die heutige Baumeistergasse (damals Einslegasse – ein Maler), und lebte bis 1947 im »zweiten Teil«. »In der Erinnerung kommt mir alles weit und luftig vor«, sagt sie. »Ich habe eine schöne Kindheit und eine schlechte Jugend gehabt.« Sie erinnert sich, dass ein gewisser Herr Schmid während des Krieges kam, um für die Rote Hilfe zu sammeln. »Der schrieb Listen, wieviel er von wem bekam. Ganz schön gefährlich.« Sie weiß noch genau, wie am Nietzscheplatz gegenüber dem Kongressbad die zurückkehrenden Nazi-Soldaten ihre Waffen in den Löschtümpel schmissen und sich auszogen. »Sandleiten war wie eine kleine Stadt. Bei uns im Hof haben sich alle gekannt. Mein Vater war ein Verwahrer im Pfandl, in der Pfandleihanstalt des Dorotheum. In der Roterdschule hatte ich einige jüdische Mitschülerinnen. Ich weiß nicht, was aus denen wurde. Als Fritz zurückkam, waren alle seine Verwandten weg, die Eltern aus der Brunnengasse verschwunden, die wurden in Minsk in die Grube geschmissen. Er hatte gar niemanden mehr, er hat Familie gesucht, der Heiratsantrag hat nicht lange auf sich warten lassen.« Und sie nahm den Antrag ganz alleine an. »Er lebte in einer kleinen Wohnung in der Wilhelminenstraße 70. Er wollte immer, dass ich mit ihm hinaufkomme, aber das habe ich nie gemacht.« Bis sie nach der Heirat zu ihm zog. Frau Roubicek, die fünf Prozent Sehvermögen hat und nur noch graue Figuren bis auf drei Meter erkennen kann, schaut sinnierend in die Luft. Die weite Aussicht auf die Hügel über den Balkon hinweg kann sie nicht mehr sehen, aber sie erinnert sich noch daran. Elegant schaut sie aus, mit ihrer goldenen Brille und dem beigen Kostüm. Sie wusste damals genau, was sie tat. Auf dem Foto von der Hakoah sieht der Schwimmer aber auch extrem fesch aus. »Seine Geschichte hat mich erschüttert. Ich habe mich sehr bemüht, ich war ja nicht schuld, ich habe aber immer etwas gut machen wollen«, sagt sie. Und nach einer Pause. »Man kann es nicht gut machen. Ich fühlte mich persönlich auch nie schuldig.«
Zweimal angespuckt
Im Sandleiten Hof hatte sie ein direktes antisemitisches Erlebnis. Unter den Arkaden am Nietzscheplatz gab es ein Zubehörgeschäft mit Zwirn und Stoffresten. »Die Mutter schickte mich 1938 um eine Handarbeit. Als ich herauskam, standen ein paar Buben in HJ-Uniform vor dem Geschäft herum. Diese Pimpfe spuckten mich an. Ich habe fürchterlich geheult. Am nächsten Tag stand in weißer Schrift »Jude« auf dem Geschäft. Da bin ich drauf gekommen, dass es auch noch andere gibt außer mir. Den Geschäftsinhaber habe ich nie wieder gesehen.« Der Name des armen Menschen war Herr Zala.
Beim SOHO-Workshop zu den zwanzig Menschen in Sandleiten, die ihre Wohnungen 1938 innerhalb von zwei Wochen räumen mussten, sitzt Frau Roubicek in der ersten Reihe. Es ist kalt unten im Museum in der Gomperzgasse 1-7, einige jüdische Männer, vor allem Kriegsversehrte des Ersten Weltkrieges, mussten auch genau von dieser Adresse wegziehen. »Wenn man ein Mahnmal für die verschwundenen Juden machen würde, wäre das gut gegen die ganzen FPÖler in unserem Bau«, sagt ein Sandleitner, der selber ein junger Wehrmachtsoldat war. Andere haben schöne Ideen für ein Mahnmal für Sandleiten.
In Gabriele Anderls und Evelyn Adunkas Buch »Jüdisches Leben in der Vorstadt Ottakring und Hernals« ist ein Auszug aus den Aufzeichnungen Fritz Roubiceks abgedruckt, in dem er von einem Vorfall, der ihn als Kind erschütterte, berichtet. Die Tochter einer Nachbarin nahm den Neunjährigen auf einen Rundgang durch die Kreuzwegstationen am Kalvarienberg mit. Dort war eine »unidentifizierbare Figur zu sehen, die ein Körbchen trug« und als »Körberljud« bezeichnet wurde. »Väter, Mütter, Onkeln, Tanten, Firmgöden und Firmgodeln forderten Franzerln, Pepperln und Loiserln auf: »Spuckts‘ eam nur schön an, den Körberljuden, den grauslichen!« Die Kinder ließen sich das nicht zweimal sagen und spuckten ins Gesicht der Figur, die trotzdem ihr Grinsen nicht verlor.« Für den kleinen Fritz bedeutete dieses Erlebnis einen Schock, der sein Leben prägte: »Hier wurde systematisch eine ganze Generation vergiftet, und wen wundert es, wenn die Franzerln, Pepperln und Loiserln des Jahres 1922 sich im Jahre 1938 am lebendigen Objekt übten.« Fritz kam ganz verstört nach Hause, weigerte sich aber der Mutter zu erzählen, was passiert war.
»Ich wollte immer, dass er über seine drei Jahre im KZ schreibt«, sagt Lilly Roubicek bedauernd. »Er hat mir viel zu Liebe getan, aber das nicht. Fritzi war in Frankreich bei der Widerstandsbewegung und schleuste Menschen, aber man hat ihn erwischt. Er war aber mit dem roten Winkel in Auschwitz, nicht mit dem Judenstern. Einmal in meinem Leben war ich schlau, sagte er, und gab ihnen den Namen des gefallenen Sohnes meiner Quartiergeberin in Frankreich. So war er als politischer Franzose inhaftiert. Als Jude hätte er nicht überlebt.«
Mit Dank an Gabriele Anderl
In Kooperation mit SOHO IN OTTAKRING